...

Definition
Der eigentliche Begriff des Karnevals ist räumlich differenziert. Je nach Region bezeichnet man ihn auch als Fastnacht, Fassenacht, Fasnacht, Fasnet, Fosnet, Faasend, Fastelov(v)end, Faslam oder Fasching.
Alle Begriffe definieren eine Zeit der Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumenden Lebensfreude vor Beginn der österlichen Fastenzeit (Passionszeit). In Deutschland und der Schweiz ist das die Spanne vom 11.11., 11:11 Uhr bis Aschermittwoch. Jedoch wird im deutschen Südwesten, der schwäbisch-alemannische Fastnacht vielerorts die Fastnacht erst an Dreikönig begonnen.
Die Bedeutung des Wortes Karneval ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt mehrere Herleitungen:
mittellat.: carnelevale (-levare) die mit der Fastenzeit bevorstehende Fleischwegnahme"
lat.: carne vale der Abschiedsruf "Fleisch lebe wohl"
im 19. Jahrhundert wurde der Begriff auch auf das römische, vorchristliche lat. carrus navalis Schiffskarren, ein Schiff auf Rädern, das bei jährlichen Umzügen zum Wiederbeginn der Schifffahrt durch die Straßen geführt wurde, zurückgeführt. Hieraus soll sich die Tradition des Narrenschiffs gebildet haben. Jedoch ergaben Forschungen, dass das Wort carrus navalis im römischen Latein nicht existiert.

Wann ist Karneval?
Der Karnevalstermin ist unmittelbar mit dem Ostertermin verbunden. Der Aschermittwoch ist kein fester sondern ein beweglicher Termin. Als feste Berechnungsgröße dient das Osterfest.
Die Urchristen feierten ihr Osterfest gemäß der jüdischen Tradition am 14. Nisan (die quarta decima) Passah. Dabei war es unerheblich, ob dieser Tag auf einen Sonntag fiel.
Im Westen hingegen wurde 325 auf dem Konzil von Nicäa die Entscheidung getroffen, daß die Christen ihr Osterfest am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond feiern. Der Ostertermin schwankt zwischen dem 22. März und 25. April (Ostergrenze). Im christlichen Festkalender geht die österliche Fastenzeit (Quadragesima) dem Osterfest voran. Somit werden Ostern und Fastenzeit zu beweglichen Terminen.
In Bezug auf das Fasten Jesu in der Wüste führte Papst Gregor I. um 600 eine 40tägige Fastenzeit vor Ostern ein, die an die Zeit erinnern soll, die Jesus Christus in der Wüste verbracht hat. Nach dieser Regelung begann die Fastenzeit am Dienstag nach dem 6. Sonntag vor Ostern.
Mit der Synode von Benevent im Jahr 1091 wurden die sechs Sonntage vor Ostern vom Fasten ausgenommen. So rückte der Beginn der Fastenzeit um sechs (Wochen-)Tage nach vorne auf den heutigen Aschermittwoch vor.
Die Karnevalszeit endet seitdem am Dienstag nach dem 7. Sonntag vor Ostern und die Fastenzeit beginnt mit dem folgenden Mittwoch, dem Aschermittwoch.
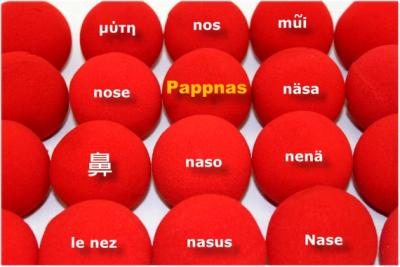
Geschichtlicher Hintergrund
Bei den Christen gilt die Fastenzeit als sogenannte gebundene Zeit. Die Christen sind an Verplichtungen wie die Pflicht zum Fasten (= Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte und Eier), Mitfeier der Karwoche und der österlichen Gottesdienste, Teilnahme an der Osterbeichte.
Die närrische Zeit umfaßt eigentlich nur 6 Tage (Weiberfastnacht bis Veilchendienstag). Diese Tage der Ausgelassenheit und des Feierns beziehen ihren Sinn von der ab Aschermittwoch folgenden Fastenzeit. Während die Fastenzeit eine Zeit des Geistes und der Vorbereitung auf Leiden, Sterben und Auferstehung Christi ist, spielt die Fastnacht vor dem Schwellentag „Aschermittwoch" sprichwörtlich verrückt.
Im Gegensatz dazu hat sich der rheinische Karneval als Gegnerschaft zur napoleonischen und preußischen Besatzung entstanden. Der Elferrat weist auf den elfköpfigen Jakobinerrat der französischen Revolution hin, der sich durch die Zahl von den 12 Aposteln unterscheiden wollte.

Das_Böse1991 - 17. Feb, 08:14
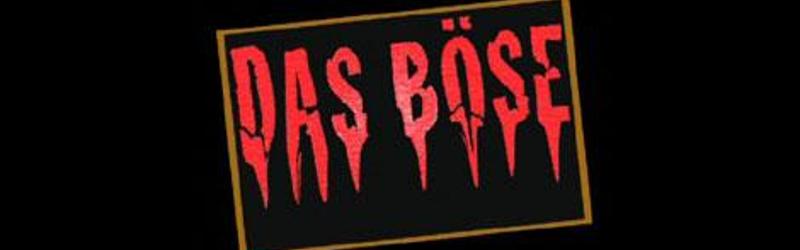
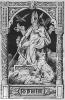
Auferstehung
(Nag Hammadi Library / Philippusevangelium / Spruch 21)
Die Auferstehung ist ein Erkenntnisprozess und nicht das "Herausklettern des toten Jesus aus seinem Grab".
Selbst wenn es sich nicht anhand der originalen Heiligen Schrift (die Bibel nur bis Genesis 11,9 sowie ein wesentlicher Teil der Nag Hammadi Schriften), die dadurch gekennzeichnet ist, dass ihre Verfasser die wirkliche Bedeutung der in Genesis 3,1-24 beschriebenen Erbsünde noch kannten, eindeutig beweisen ließe, dass Jesus von Nazareth der erste Denker in der bekannten Geschichte war, der die Grundprinzipien der Natürlichen Wirtschaftsordnung erkannte, wäre es noch immer hochgradig unwahrscheinlich, dass die berühmteste Persönlichkeit der Welt, auf der bis heute die planetare Zeitrechnung basiert, irgendetwas anderes entdeckt haben könnte, denn allgemeiner Wohlstand auf höchstem technologischem Niveau, eine saubere Umwelt und der Weltfrieden sind ohne eine konstruktive Geldumlaufsicherung in Verbindung mit einem allgemeinen Bodennutzungsrecht prinzipiell unmöglich.
Die originale Heilige Schrift ist aufgebaut wie ein komplexes Gleichungssystem, in dem archetypische Bilder und Metaphern die "Unbekannten" darstellen. Das Gleichungssystem hat nur genau eine Lösung, die einen vollkommenen Sinn ergibt und die gesamte Kulturgeschichte der halbwegs zivilisierten Menschheit seit dem "Auszug der Israeliten aus Ägypten" bis heute erklärt. Bei der Vielzahl von Gleichnissen, insbesondere in den Nag Hammadi Schriften, in denen immer wieder die gleichen Bilder und Metaphern in vielen Kombinationen und Zusammenhängen verwendet werden, wäre es absolut unmöglich, den makroökonomischen Sinngehalt "hineinzuinterpretieren" – und das auch noch mit 100-prozentiger Signifikanz –, wenn die originale Heilige Schrift irgendeine andere Bedeutung hätte, als die in "Der Weisheit letzter Schluss" beschriebene: http://www.deweles.de